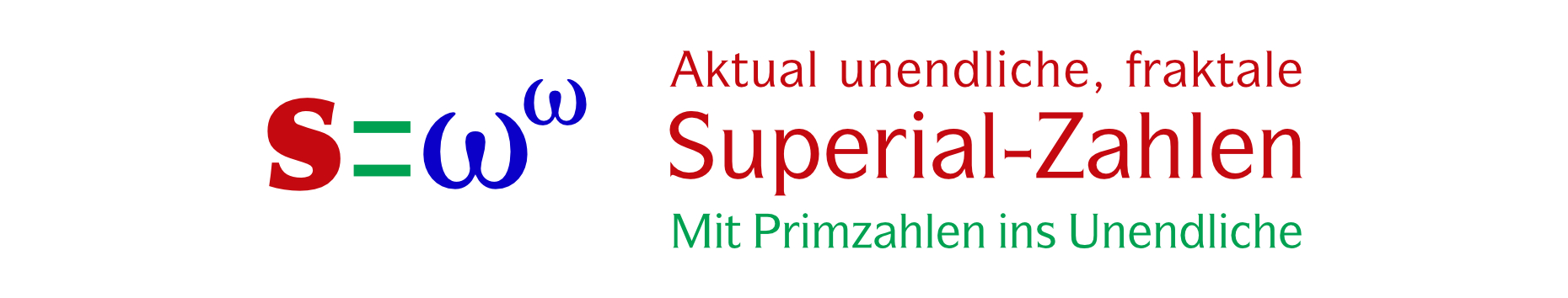| ← |
Superiale-Transzendenz-Vermutung (STV)
Wir vermuten, dass alle transzendenten Zahlen superial kleine Summanden besitzen und damit im aktual unendlich kleinen keine rein endlichen Zahlen sind
| ▾ | Notizen |
Erklärungs-Video
• DiBeos: Warum sind transzendente Zahlen so interessant?.
Die Superial-Zahlen sind eine Lupe in die Details der reellen Zahlen, in die reell algebraischen wie auch in die transzendenten Zahlen.
Die reell algebraischen Zahlen sind von ihrer Struktur her recht gut bekannt. So konnten wir bereits zeigen, dass sie alle sinnvolle Koeffizienten des Stellenwertsystems der Superial-Zahlen sind. Ganz anders die transzendenten Zahlen. Über sie ist im wesentlichen nur bekannt, dass sie alle Zahlen sind, die nicht zu den algebraischen gehören. Ein zwar klares, aber auch recht allgemeines Kriterium, dass nicht viel über ihre Struktur aussagt.
Sollte die Vermutung stimmen, dass alle transzendenten Zahlen superial kleine Summanden enthalten, der sich dieses Kapitel widmet, dann wären die reell algebraischen Zahlen die vollständigen sinnvollen Koeffizienten des Stellenwertsystems der Superial-Zahlen.
Die transzendente eulersche Zahl $ \e $
Eine transzendente Zahl durch die Lupe der Superial-Zahlen
Die Superial-Zahlen wurden ja aus der Idee geboren mit ihren aktual unendlichen und infinitesimalen Größen Ableitungen und Integrale zu Formulieren, anstatt mit dem Limes zu rechnen. Dies ist uns gelungen, wodurch die Superial-Zahlen auch als Zahlentheorie der Analyses verstanden werden können.
Eine Fragestellung, die sich daraus ergibt ist: Welche Funktion ist ihre eigene Ableitung oder ihre eigenes Integral?
Dies lässt sich aufgrund unseres entwickelten Formalismus berechnen, wie wir mit Formel SN.EuZa.15 sehen:
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \e_{\s}^{x}\;\;\;=\;\;\;\langle 1\rangle .\!\langle 1\rangle ^{\langle x\rangle _{1}} } \] | (SN.EuZa.15) |
Hier ist die eulersche Zahl $ \e_{\s} $ mit der superialen Basis $ \s $ indexiert, um zu kennzeichnen, dass der Formalismus zu ihrer Berechnung auf Superial-Zahlen basiert.
Die eulersche Zahl ist nun bekanntermaßen eine transzendente Zahl. Nähern wir sie nicht mit dem Limes an, sondern definieren und berechnen wir sie mit den aktual unendlichen Superial-Zahlen, indem wir $ \e_{\s} $ berechnen, dann erhalten wir:
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \e_{\s}\;\;\;=\;\;\;\e_{\s}^{1}\;\;\;=\;\;\;\langle 1\rangle .\!\langle 1\rangle ^{\langle 1\rangle _{1}} } \] | (SN.EuZa.78) |
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Leftrightarrow\hspace{10mm}\e_{\s}\;\;\;=\;\;\;\left\langle 1 + 1 + \frac{ 1^{2} }{ 2 } + \frac{ 1^{3} }{ 6 } + \cdots \right\rangle .\! \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \left\langle - \frac{ 1 }{ 2 } - \frac{ 3 \cdot 1^{2} }{ 6 } + \cdots \right\rangle \left\langle \frac{ 2 }{ 6 } + \cdots \right\rangle \cdots \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\; \cdots \left\langle \cdots + \frac{ 1^{3} }{ 6 } \right\rangle \left\langle \cdots - \frac{ 3 \cdot 1^{2} }{ 6 } \right\rangle \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad\; \left\langle \cdots + \frac{ 2 }{ 6 } + \frac{ 1^{2} }{ 2 } \right\rangle \left\langle - \frac{ 1 }{ 2 } \right\rangle \left\langle 1 \right\rangle \left\langle 0 \right\rangle \left\langle 1 \right\rangle _{-\s} } \] | (SN.EuZa.81) |
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Leftrightarrow\hspace{10mm}\e_{\s}\;\;\;=\;\;\;\left\langle \sum_{ \forall k \in \mathbb{N} } \frac{ 1^{k} }{ k! } \right\rangle .\! \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \left\langle - \frac{ 1 }{ 2 } - \frac{ 3 \cdot 1^{2} }{ 6 } + \cdots \right\rangle \left\langle \frac{ 2 }{ 6 } + \cdots \right\rangle \cdots \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\; \cdots \left\langle \cdots + \frac{ 1^{3} }{ 6 } \right\rangle \left\langle \cdots - \frac{ 3 \cdot 1^{2} }{ 6 } \right\rangle \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad\; \left\langle \cdots + \frac{ 2 }{ 6 } + \frac{ 1^{2} }{ 2 } \right\rangle \left\langle - \frac{ 1 }{ 2 } \right\rangle \left\langle 1 \right\rangle \left\langle 0 \right\rangle \left\langle 1 \right\rangle _{-\s} } \] | (SN.EuZa.111) |
Wir können hier sehen, dass wir im endlichen Anteil der superialen Stellenwert-Zahl die bekannte Definition der eulerschen Zahl finden:
Darüber hinaus sehen wir oben in Formel SN.EuZa.111 Stellen, die genau bis zum superial kleinen Summanden der Stelle $ -\s $ hinunter reichen. Deshalb ist die eulersche Zahl sogar eine Zahl die nicht zu den auf dieser Seite beschriebenen Superial-Zahlen gehört, sondern eine Erweiterung dieser darstellt, die auch superiale Exponenten der superialen Basis $ \s $ zulassen, hier $ \s^{-\s} $.
Unsere Vermutung, dass transzendente Zahlen immer superial kleine Summanden besitzen
Zum einen haben wir gezeigt, dass alle reell algebraischen Zahlen sinnvolle Koeffizienten der Superial-Zahlen sind. Zum anderen sehen wir hier an $ \e_{\s} $, einer der relativ wenigen bekannten transzendenten Zahlen, dass sie sehr viele superial kleine Summanden enthält.
So liegt die Vermutung in der Luft, dass alle transzendenten Zahlen superial kleine Summanden enthalten, sollten die reell algebraischen Zahlen wirklich die vollständigen Koeffizienten der Superial-Zahlen sein. Denn die reell algebraischen Zahlen sind dann alle Zahlen unter den reellen Zahlen, die keine superial kleinen Summanden enthalten. Und da alle Zahlen auf dem reellen Zahlenstrahl, die nicht reell algebraisch sind, per Definition transzendent sind, müssen alle transzendenten Zahlen superial kleine Summanden enthalten.
Wir sehen …
Es ist eigentlich die Vermutung, dass die reell algebraischen Zahlen die vollständigen Koeffizienten der Superial-Zahlen sind
Wie kommen wir zu dem Wissen, dass die reell algebraischen Zahlen die vollständigen Koeffizienten der Superial-Zahlen sind?
Wir müssen zeigen, dass die reell algebraischen Zahlen nicht nur eine Teilmenge von oder gleich den sinnvollen Koeffizienten sind. Sondern auch, dass die sinnvollen Koeffizienten eine Teilmenge von oder gleich den reell algebraischen Zahlen sind. Dann folgt zusammen die Gleichheit:
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \mathbb{A}_{\R}\;\;\;\subseteq\;\;\;\mathbb{A}_{\S} } \] | (SN.AKV.20) |
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \mathbb{A}_{\S}\;\;\;\overset{?}{\subseteq}\;\;\;\mathbb{A}_{\R} } \] | (SN.Tra.2) |
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Rightarrow\hspace{10mm}\mathbb{A}_{\S}\;\;\;\overset{?}{=}\;\;\;\mathbb{A}_{\R} } \] | (SN.Tra.3) |
Beweis über das superiale Kronecker-Kriterium (SKK)
Über das superiale Kronecker-Kriterium nehmen wir nachfolgend den Beweis der Superialen-Transzendenz-Vermutung in Angriff.
Glossar
| • |
endliche Primzahl: eine Primzahl $ p \in \mathbb{P} = \left\{ 2, 3, 5, \cdots \right\} $ aus $ \mathbb{N} $, als Element in $ \mathbb{S}_{\Z} $ eingebettet. |
| • |
superiale Primzahl: Primelement in $ \mathbb{S}_{\Z}\!: \; p_{\s} \ne 0 $, $ p_{\s} $ keine Einheit, und $ p_{\s} \mid ab \;\Leftrightarrow\; p_{\s} \mid a \; $ oder $ \; p_{\s} \mid b \; $. („aktual unendliche Primzahl“ in unserer Sprache.) |
| • |
Primideal: primes Ideal (zum Beispiel $ p \mathbb{S}_{\Z} $, $ ⟨p_{\s}⟩ $). |
Hinweis: „aktual unendlich“ bezieht sich hier auf die Skala/Basis $ \s $. Bei „superialer Primzahl“ meinen wir ringtheoretische Primheit in $ \mathbb{S}_{\Z} $, nicht unbedingt „unendlich große“ numerische Größe.
Terminologie
Im Folgenden bedeutet „Primzahl“ stets endliche Primzahl (das heißt eine Primzahl aus $ \mathbb{Z} $). Unter „superialer Primzahl“ verstehen wir ein Primelement in $ \mathbb{S}_{\Z} $ (aktual-unendliche Primzahl). Bewertungen $ v_{p} $, Ideale $ p \mathbb{S}_{\Z} $ und alle Teilbarkeitsaussagen sind über endliche Primzahlen $ p $ indiziert.
Ansatz superiales Kronecker-Kriterium
Unser Ansatz in Kurzform.
Die Idee in einem Satz
Ein reeller Wert $ \alpha $ aus $ \mathbb{A}_{\S} $ ist genau dann algebraisch, wenn man zu jedem $ k $ ein ganzzahliges Polynom $ P_{k} $ findet, das $ \alpha $ gleichzeitig (i) in allen nichtarchimedischen Bewertungen „sehr teilbar“ macht und (ii) archimedisch „sehr klein“ auswertet – und zwar so kohärent, dass die Folge $ (P_{k}) $ zu einem monischen Grenzpolynom $ P \in \mathbb{Z}[x] $ mit $ P(\alpha) = 0 $ stabilisiert.
Was heißt das konkret?
Für $ \alpha \in \mathbb{A}_{\S} $ betrachten wir $ \Phi_{P}(\alpha) ≔ P(\alpha) \s^{\mathrm{deg} P} \in \mathbb{S} $. Das SKK fordert eine Folge $ P_{k} \in \mathbb{Z}[x] $ mit:
1. $ p $-adische Seite (global, alle endlichen Primzahlen):
$ \mathrm{deg} P_{k} \ge k \Rightarrow $ (wegen „$ \s $ trägt alle Primzahlen“)
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Phi_{P_{k}}(\alpha)\;\;\;\in\;\;\;p^{k} \mathbb{S}_{\Z} } \] | (SN.Tra.4) |
fÜr alle endlichen Primzahlen $ p $. (Das ist der „superiale Schub“: die Schichtverschiebung mit $ \s^{\mathrm{deg} P_{k}} $ erzwingt simultane hohe $ p $-Adizität.)
2. archimedische Seite:
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \left| P_{k}(\alpha) \right| \le 2^{−k} } \] | (SN.Tra.5) |
oder ähnlich streng $ e^{− C k} $.
3. Kohärenz und Monizität:
Die $ P_{k} $ liegen in wachsend feinen Restklassen $ P_{k + 1} \equiv P_{k} \; (\mathrm{mod} \, M_{k}) $ (mit $ M_{k + 1} \ge 2 M_{k} $) und sind monisch;
zudem wählen wir stets „kleinste Repräsentanten“ der Koeffizienten (Höhenkontrolle).
Warum reicht das? (Mechanik des Beweises)
| • |
Aus 1) folgt $ \Phi_{P_{k}}(\alpha) \in \bigcap_{p} p^{k} \mathbb{S}_{\Z} $ für alle $ k $ (stärkste nichtarchimedische Kleinschätzung). |
| • |
Aus 2) folgt $ P_{k}(\alpha) \rightarrow 0 $ in der reellen Stelle. |
| • |
Die Kohärenz aus 3) und die Höhenkontrolle erzwingt eine stationäre Koeffizientenfolge (profiniter Diagonal-Schritt): $ P_{k} \rightarrow P \in \mathbb{Z}[x] $, monisch. |
| • |
Grenzübergang in 2) gibt $ P(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha $ ist algebraisch. |
Was unterscheidet das vom „klassischen“ Kronecker-Geist?
Der klassische Kronecker-Gedanke sagt grob: „Globale Kleinheit/Integralität an allen Stellen ⇒ Algebraizität.“
Im superialen SKK kommt die nichtarchimedische Seite fast „gratis“ durch den $ \s $-Vorrat (die Schichtverschiebung $ \s^{\mathrm{deg} P} $ liefert simultan hohe $ p $-Adizität für alle endlichen Primzahlen), während die archimedische Seite über Dirichlet/Siegel (Geometrie der Zahlen) gesteuert wird. Die profinite Kohärenz sorgt schließlich dafür, dass die Kleinheiten nicht nur „näherungsweise“, sondern exakt in einer ganzzahligen Nullstelle münden.
Kurzformel
Das bedeutet
In Worten: Gelingt es, $ \alpha $ durch eine kohärente Folge ganzzahliger Polynome zugleich überall $ p $-adisch „verschwinden zu lassen“ und reell gegen $ 0 $ zu drücken, dann muss $ \alpha $ eine Nullstelle eines monischen ganzzahligen Polynoms sein.
Unser Vorgehen
Nun unser Vorgehen etwas ausführlicher geschildert.
Entsprechend unserer Algebraischen-Koeffizienten-Vermutung (AKV)
Wir arbeiten mit $ \mathbb{S}_{\Z} $ als den ganzen Superial-Zahlen (endliche Stellensummen ohne negative $ \s $-Potenzen, mit ganzzahliger Nullstelle), $ \mathbb{S} $ als Erweiterung mit erlaubten negativen Stellen und $ \mathbb{S}_{\Q} = \mathrm{Frac}(\mathbb{S}_{\Z}) $. Sinnvolle Koeffizienten definieren wir 1-schichtig als $ \mathbb{A}_{\S} = \left\{ a \in \mathbb{R}_{\text{endlich}} ~\middle|~ a \cdot \s \in \mathbb{S}_{\Z,\{ 1 \}} \right\} $. Jedes $ X \in \mathbb{S}_{\Z} $ zerfällt eindeutig in $ X = s^{m} X^{(0)} $ (s-Ordnung), und die endliche Primunterstützung liegt im $ \s $-primitiven Teil. Für jede endliche Primzahl $ p $ verwenden wir die Bewertung $ v_{p} $ mit Valuationsring $ V_{p} = \left\{ x ~\middle|~ v_{p}(x) \ge 0 \right\} \cup \left\{ 0 \right\} $ (optional zusätzlich $ V_{s} = \left\{ x ~\middle|~ \mathrm{ord}_{\s}(x) \ge 0 \right\} \cup \left\{ 0 \right\} $. Damit erhalten wir die Schnittdarstellung $ \mathbb{S}_{\Z} = \bigcap p V_{p} $ (äquivalent $ \mathbb{S}_{\Z} = V_{s} \cap \bigcap p V_{p} $) und folgern: $ \mathbb{S}_{\Z} $ ist ganz abgeschlossen. Das Ganzheitsargument liefert sodann die AKV-Richtung $ \mathbb{A}_{\R} \subseteq \mathbb{A}_{\S} $: Für reell algebraisches $ \alpha $ ist $ Y = \alpha \s $ Nullstelle eines monischen Polynoms über $ \mathbb{S}_{\Z} $, also $ Y \in \mathbb{S}_{\Z} $ und damit $ \alpha \in \mathbb{A}_{\S} $.
Zusätzliche für den Beweis unsere Superialen-Transzendenz-Vermutung (STV)
Für die Gegenrichtung (STV) beobachten wir heuristisch: In einer limitfreien Superial-Auswertung behalten transzendente Konstanten wie $ \e $, $ π $, $ \ln 2 $, $ ζ(2) $ sichtbare $ s^{−k} $-Korrekturen, während rein algebraische Konstruktionen 1-schichtig bleiben. Formal beweisen wir dies über das Superiale Kronecker-Kriterium: Aus $ \alpha \in \mathbb{A}_{\S} $ konstruieren wir Polynome $ P_{k} \in \mathbb{Z}[x] $ mit $ \mathrm{deg} P_{k} \ge k $ und $ \left| P_{k}(\alpha) \right| \le 2^{−k} $, kohärent modulo wachsender Moduli $ M_{k} $. Der $ p $-adische Teil kommt „gratis“ aus $ \s $: $ \mathrm{deg} P_{k} \ge k \Rightarrow v_{p}(\Phi_{P_{k}}(\alpha)) \ge k $ simultan für alle $ p $. Den archimedischen Teil liefert Dirichlet/Siegel (Geometrie der Zahlen(Verweis)) mit vorgegebener Restklasse, und eine profinite Diagonalauswahl stabilisiert die Koeffizienten zu einem monischen Grenzpolynom $ P \in \mathbb{Z}[x] $ mit $ P(\alpha) = 0 $. Damit ist $ \alpha $ algebraisch, also $ \mathbb{A}_{\S} \subseteq \mathbb{A}_{\R} $. Zusammen mit AKV folgt schließlich die Gleichheit $ \mathbb{A}_{\S} = \mathbb{A}_{\R} $.
Rahmen und Notation
Wir setzen:
| • |
$ \mathbb{S}_{\Z} = V_{s} \cap \bigcap p V_{p} $ (Schnitt über alle endlichen Primzahlen $ p $); $ \mathbb{S}_{\Q} = \mathrm{Frac}(\mathbb{S}_{\Z}) $). |
| • |
$ \s $ „trägt alle Primzahlen“; in $ \mathbb{S} $ sind negative $ \s $-Exponenten erlaubt, in $ \mathbb{S}_{\Z} $ nicht und die nullte Schicht darf nur ganzzahlig sein. |
| • |
$ \mathbb{A}_{\S} ≔ \left\{ a \in \mathbb{R}_{\text{endlich}} ~\middle|~ a \cdot \s \in \mathbb{S}_{\Z,\{ 1 \}} \right\} $ (nur die Schicht $ s^{1} $ belegt). |
| • |
Für $ P(x) = \sum_{i = 0}^{d} c_{i} x_{i} \in \mathbb{Z}[x] $ setzen wir |
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Phi_{P}(\alpha)\;\;\;≔\;\;\;P(\alpha) \cdot \s^{d}\;\;\;\in\;\;\;\mathbb{S} \;\; . } \] | (SN.Tra.13) |
Mit $ T ≔ \alpha \cdot \s \in \mathbb{S}_{\Z,\{ 1 \}} $ gilt in $ \mathbb{S} $ auch
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Phi_{P}(\alpha)\;\;\;=\;\;\;\sum_{i = 0}^{d} c_{i} T^{i} \; \s^{d - i} \;\; . } \] | (SN.Tra.14) |
Drei Schlüssellemmata
1) $ p $-adischer „Schub“ aus $ s $
Lemma – Uniforme $ p $-Adik:
Sei $ \alpha \in \mathbb{A}_{\S} $.
Für jedes $ P \in \mathbb{Z}[x] $ mit $ \mathrm{deg} P = d $ und jede endliche Primzahl $ p $ gilt
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { v_{p}(\Phi_{P}(\alpha)) \ge d \;\; . } \] | (SN.Tra.15) |
Insbesondere $ \Phi_{P}(\alpha) \in p^{d} \mathbb{S}_{\Z} $, also $ \Phi_{P}(\alpha) \in \bigcap_{p} p^{d} \mathbb{S}_{\Z} $.
Beweis: Schreibe $ \Phi_{P}(\alpha) = \sum_{i = 0}^{d} c_{i} T^{i} \; \s^{d - i} $ mit $ T = \alpha \cdot \s \in \mathbb{S}_{\Z} $. Da $ p \mid \s $ und $ p \mid T $ für alle endlichen Primzahlen $ p $, hat jeder Summand $ p $-Bewertung $ \ge i \cdot 1 + ( d − i ) \cdot 1 = d $. Die Summe erbt $ v_{p} \ge d $. $ \blacksquare $
Konsequenz: Für das p-adische Ziel $ v_{p}(\Phi_{P_k}(\alpha)) \ge k $ genügt schlicht $ \mathrm{deg} P_k \ge k $. Keine Feinabstimmung-Kongruenzen nötig.
2) Archimedisch kleine Werte mit vorgegebener Restklasse
Hilfsnotation: $ d \ge 1 $ und $ M \ge 2 $ und eine Restklasse $ \overline{C} = (\overline{c}_{0}, \cdots , \overline{c}_{d}) \in (\mathbb{Z} / M \mathbb{Z})^{d + 1} $ wählen wir einen festen Vertreter $ C^{0} = (c_{0}^{0}, \cdots , c_{d}^{0}) \in \mathbb{Z}^{d + 1} $ mit
Lemma – Dirichlet–Siegel mit Restklassen und Monizität:
Sei $ \alpha \in \mathbb{R}_{\text{endlich}} $, $ d \ge 1 $, $ M \ge 2 $, $ \epsilon > 0 $ und $ \overline{C} $ wie oben mit $ \overline{c}_{d} \equiv 1 \; (\mathrm{mod} \, M) $.
Dann existiert ein monisches $ P(x) = \sum_{i = 0}^{d} c_{i} x^{i} \in \mathbb{Z}[x] $ mit
und Höhenkontrolle
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \max_{0 \le i \le d} \left| c_{i} \right| \;\;\;\le\;\;\; \left| c_{i}^{0} \right| + M H \;\; (0 \le i \le d - 1) \;\; , } \] | (SN.Tra.22) |
wobei man $ H $ so wählen kann, dass
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { H \;\;\;\le\;\;\; C(d, \alpha) \left( \frac{ M }{ \epsilon } \right)^{\frac{ 1 }{ d }} \;\; . } \] | (SN.Tra.23) |
Beweis:
Fixiere $ C_{0} $ wie oben und setze $ m_{d} ≔ 0 $.
Betrachte Vektoren $ m = (m_{0}, \cdots ,m_{d − 1}) $ mit $ 0 \le m_{i} \le H $ ganzzahlig.
Definiere
und
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { P(x)\;\;\;=\;\;\;\sum_{i = 0}^{d} c_{i} x^{i} \;\; . } \] | (SN.Tra.26) |
Dann $ P \equiv \overline{C} \; (\mathrm{mod} \, M) $ und $ P $ ist monisch.
Setze $ L_{\alpha}(m) ≔ \sum_{i = 0}^{d - 1} m_{i} \alpha^{i} $. Die Menge $ \left\{ L_{\alpha}(m) ~\middle|~ 0 \le m_{i} \le H \right\} $ hat $ ( H + 1 )^{d} $ Elemente und liegt in einem Intervall der Länge
Zerlege dieses Intervall in $ ( H + 1 )^{d} $ gleichlange Teilintervalle der Länge $ \le L / ( H + 1 )^{d} \le C( d, \alpha ) / H^{d} $. Wähle $ m $ so, dass
Dann
Wähle $ H \ge \left( C(d, \alpha ) M / \epsilon \right)^{1 / d} $. Damit $ \left| P(\alpha) \right| \le \epsilon $ und die Höhenabschätzung folgt aus der Definition von $ c_{i} $. $ \blacksquare $
Bemerkung (minimale Repräsentanten): Wählt man $ m_{i} $ zusätzlich so, dass $ \left| c_{i} \right| \le M / 2 $ stets gilt (durch geeignetes „Zentrieren“ der Box), erhält man die Minimalrepräsentanten $ \left| c_{i} \right| \le M / 2 $, was wir gleich für die Stabilisierung nutzen.
3) Stabilisierung von Koeffizienten (profiniter Diagonal-Schritt)
Lemma – Kohärente Folge $ \Rightarrow $ stationäre Koeffizienten:
Sei $ M_{1} | M_{2} | M_{3} | \cdots $ mit $ M_{k + 1} \ge 2 M_{k} $.
Sei $ P_{k}(x) = \sum_{i = 0}^{d_{k}} c_{i}^{(k)} x^{i} \in \mathbb{Z}[x] $ eine Folge mit
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { P_{k + 1} \;\;\;\equiv\;\;\; P_{k} \; (\mathrm{mod} \, M_{k}) } \] | (SN.Tra.30) |
und
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \left| \, c_{i}^{(k)} \right| \;\;\;\le\;\;\; \frac{ M_{k} }{ 2 } \;\; ( 0 \le i \le d_{k} ) \;\; . } \] | (SN.Tra.31) |
Dann existieren Integers $ c_{i} $ (für alle $ i \ge 0 $) mit $ c_{i}^{(k)} = c_{i} $ für alle genügend großen $ k $ (für jedes feste $ i $). Insbesondere konvergiert $ P_{k} $ koeffizientenweise zu einem $ P \in \mathbb{Z}[x] $.
Beweis:
Fixiere $ i $.
Aus $ P_{k + 1} \equiv P_{k} \; (\mathrm{mod} \, M_{k}) $ folgt $ c_{i}^{(k + 1)} − c_{i}^{(k)} = t_{k} M_{k} $ mit $ t_{k} \in \mathbb{Z} $.
Wegen $ \left| c_{i}^{(k + 1)} − c_{i}^{(k)} \right| \le \left| c_{i}^{(k + 1)} \right| + \left| c_{i}^{(k)} \right| \le M_{k + 1} / 2 + M_{k} / 2 \le M_{k + 1} − M_{k} $ und $ M_{k + 1} \ge 2 M_{k} $ erzwingt dies $ t_{k} \in \{ −1, 0, 1 \} $, ja sogar für große $ k \cdot t_{k} = 0 $.
Also stationär. $ \blacksquare $
Hauptsatz und Beweis
Satz – Superiales Kronecker-Kriterium:
Sei $ \alpha \in \mathbb{A}_{\S} $.
Dann existiert ein monisches $ P \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{ 0 \} $ mit $ P(\alpha) = 0 $.
In Verbindung mit AKV folgt
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \mathbb{A}_{\S}\;\;\;=\;\;\;\mathbb{A}_{\R} \;\; . } \] | (SN.Tra.32) |
Beweis:
Wir konstruieren induktiv $ P_{k} \in \mathbb{Z}[x] $ und Moduli $ M_{k} $ so, dass
| • |
(A) $ \mathrm{deg} P_{k} = d_{k} \ge k $ ($ p $-adischer Schub), |
| • |
(B) $ \left| P_{k}(\alpha) \right| \le 2^{−k} $ (archimedisch klein), |
| • |
(C) $ P_{k + 1} \equiv P_{k} \; (\mathrm{mod} \, M_{k}) $ (Kohärenz), |
| • |
(D) $ \max_{i} \left| \, c_{i}^{(k)} \right| \le \frac{ M_{k} }{ 2 } $ (minimale Repräsentanten), |
| • |
(E) $ P_{k} $ monisch. |
Start:
Setze $ M_{1} ≔ 2 $.
Wende Lemma – Dirichlet–Siegel mit Restklassen und Monizität mit $ d_{1} = 1 $, $ \epsilon = 1 / 2 $, Restklasse $ \overline{C} $ mit $ \overline{c}_{1} \equiv 1 \; (\mathrm{mod} \, 2) $ an.
Erhalte monisches $ P_{1} $ mit $ \left| P_{1}(\alpha) \right| \le 1 / 2 $ und (D).
Induktionsschritt $ k \rightarrow k + 1 $:
Wähle $ M_{k + 1} ≔ 2 M_{k} $ (so $ M_{k + 1} \ge 2 M_{k} $ und $ M_{k} \mid M_{k + 1} $).
Wähle einen Zielgrad $ d_{k + 1} \ge k + 1 $ und eine Restklasse $ \overline{C}^{(k + 1)} \in (\mathbb{Z} / M^{k+1} \mathbb{Z})^{d_{k + 1} + 1} $ mit
Wende Lemma – Dirichlet–Siegel mit Restklassen und Monizität mit $ \epsilon = 2^{− (k + 1)} $ an und nimm den eindeutigen Repräsentanten mit $ \left| \, c_{i}^{(k + 1)} \right| \le M_{k + 1} / 2 $. So erhalten wir $ P_{k + 1} $ mit (B), (C), (D), (E); (A) ist per Wahl $ d_{k + 1} \ge k + 1 $ erfüllt.
$ p $-adische Seite:
Aus (A) und Lemma – Uniforme $ p $-Adik folgt für alle endlichen Primzahlen $ p $:
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { v_{p}(\Phi_{P}(\alpha)) \ge d_{k} \ge k \;\; . } \] | (SN.Tra.35) |
Koeffizienten-Stabilität:
Wegen (C), (D) und $ M_{k+1} \ge 2 M_{k} $ liefert Lemma – Kohärente Folge $ \Rightarrow $ stationäre Koeffizienten eine koeffizientenweise Konvergenz $ P_{k} \rightarrow P \in \mathbb{Z}[x] $ und $ P $ ist monisch (per (E)).
Grenzübergang:
Aus (B) folgt $ P(\alpha) = \mathrm{lim}_{k} P_{k}(\alpha) = 0 $.
Damit existiert ein monisches $ P \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{ 0 \} $ mit $ P(\alpha) = 0 $.
Also $ \alpha $ algebraisch. $ \blacksquare $
Schluss:
Da wir bereits (AKV) $ \mathbb{A}_{\R} \subseteq \mathbb{A}_{\S} $ bewiesen haben, liefert der Satz $ \mathbb{A}_{\S} \subseteq \mathbb{A}_{\R} $ und damit
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \boxed{\;\; \mathbb{A}_{\S}\;\;\;=\;\;\;\mathbb{A}_{\R} \;\;} \;\; . } \] | (SN.Tra.36) |
Zusammenfassung der Beweisschritte
Wir lassen unsere gegangenen Beweisschritte noch einmal Revue passieren:
| • |
Nur die 1-Schicht-Definition $ \mathbb{A}_{\S} = \left\{ a \in \mathbb{R}_{\text{endlich}} ~\middle|~ a \cdot \s \in \mathbb{S}_{\Z,\{ 1 \}} \right\} $ sowie „$ \s $ trägt alle endlichen Primzahlen“ gingen in Lemma – Uniforme $ p $-Adik ein. |
| • |
Der archimedische Teil (Lemma – Dirichlet–Siegel mit Restklassen und Monizität) ist reine Geometrie der Zahlen plus Restklassen-Fixierung; Monizität lässt sich über $ \overline{c}_{d} \equiv 1 $ erzwingen. |
| • |
Die Stabilisierung (Lemma – Kohärente Folge $ \Rightarrow $ stationäre Koeffizienten) nutzt allein $ M_{k + 1} \ge 2 M_{k} $ und Minimalrepräsentanten. |
| • |
Der $ p $-adische „Schub“ ist uniform: $ \mathrm{deg} P_{k} \ge k \Rightarrow v_{p}(\Phi_{P_{k}}(\alpha)) \ge k $ simultan für alle $ p $. |
Fazit
So erreichen wir den Nachweis, dass der Übergang von der endlichen, nullten Schicht oder Stelle des Stellenwertsystems der Superial-Zahlen zu zusätzlichen superialen Nachkommastellen, die nicht alle Null sind, – also durch das Hinzufügen von aktual unendlich kleinen Summanden zu endlichen reell algebraischen Zahlen –, aus Perspektive der Superial-Zahlen, tatsächlich auch dem Übergang von den reell algebraischen Zahlen zu den transzendenten Zahlen entspricht.
Daraus folgt dann auch
wie bekannt.
Die Superial-Zahlen stellen die reellen Zahlen in ein neues Licht
Die Veränderung unserer Perspektive von genereller Anwendung des Limes hin zu aktualer Unendlichkeit, wo dies möglich ist, eröffnet auch eine neue Perspektive auf die reellen Zahlen $ \mathbb{R} $, wie wir erkennen.
Dies ist die Perspektive der Superial-Zahlen und deren Erweiterungen, in der die Definition der reellen Zahlen, in Form von superialen reellen Zahlen $ \mathbb{R}_{\S} $ oder $ \mathbb{S}_{\R} $, dann zu überdenken ist.
Diese Sicht offenbart die tiefe Verbindung des Zählens und der endlichen Primzahlen mit dem Aktual-Unendlichen.
Das Langlands-Programm
Eben diese Verbindung des Zählens und der endlichen Primzahlen mit dem Aktual-Unendlichen erhellt nicht nur die Grenzen zwischen den algebraischen Zahlen und den transzendenten Zahlen, sondern lässt gleichzeitig auch eine tiefe Verbindung zwischen Geometrie, Algebra und Analysis erkennbar werden.
Wenn sich dies so bestätigt, sind die Superial-Zahlen ein wichtiger Baustein des Langlands-Programms.
| ▾ | Beweisentwurf: |
Rahmen und Notation
Wir setzen:
| • |
$ \mathbb{S}_{\Z} = V_{s} \cap \bigcap p V_{p} $ (Schnitt über alle endlichen Primzahlen $ p $); $ \mathbb{S}_{\Q} = \mathrm{Frac}(\mathbb{S}_{\Z}) $). |
| • |
$ \s $ „trägt alle Primzahlen“; in $ \mathbb{S} $ sind negative $ \s $-Exponenten erlaubt, in $ \mathbb{S}_{\Z} $ nicht und die nullte Schicht darf nur ganzzahlig sein. |
| • |
$ \mathbb{A}_{\S} ≔ \left\{ a \in \mathbb{R} ~\middle|~ a \cdot \s \in \mathbb{S}_{\Z,\{ 1 \}} \right\} $ (nur die Schicht $ s^{1} $ belegt). |
| • |
Für $ P(x) = \sum_{i = 0}^{d} c_{i} x_{i} \in \mathbb{Z}[x] $ setze |
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Phi_{P}(\alpha)\;\;\;≔\;\;\;P(\alpha) \cdot \s^{d}\;\;\;\in\;\;\;\mathbb{S} \;\; . } \] | (SN.Tra.39) |
Schreibe $ T ≔ \alpha \cdot \s \in \mathbb{S}_{\Z,\{ 1 \}} $. Dann gilt in $ \mathbb{S} $ auch
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Phi_{P}(\alpha)\;\;\;=\;\;\;\sum_{i = 0}^{d} c_{i} T^{i} \; \s^{d - i} \;\; \text{(Summe ganzer Superial-Zahlen)} \;\; . } \] | (SN.Tra.40) |
$ p $-adischer „Schub“ aus der Schichtenstruktur
Lemma – Schichten-bedingte $ p $-Adik:
Sei $ \alpha \in \mathbb{A}_{\S} $.
Für jedes $ P \in \mathbb{Z}[x] $ mit $ \mathrm{deg} P = d $ und jede endliche Primzahl $ p $ gilt
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { v_{p}(\Phi_{P}(\alpha)) \ge d \;\; . } \] | (SN.Tra.41) |
Insbesondere $ \Phi_{P}(\alpha) \in p^{d} \mathbb{S}_{\Z} $, also $ \Phi_{P}(\alpha) \in \bigcap_{p} p^{d} \mathbb{S}_{\Z} $.
Beweis (1 Zeile): Schreibe $ \Phi_{P}(\alpha) = \sum_{i = 0}^{d} c_{i} T^{i} \; \s^{d - i} $ mit $ T = \alpha \cdot \s $. Da $ v_{p}(\s) \ge 1 $ und $ v_{p}(T) \ge 1 $ für alle $ p $, hat jeder Summand $ p $-Bewertung $ \ge i \cdot 1 + ( d − i ) \cdot 1 = d $; damit auch die Summe. $ \blacksquare $
Konsequenz: Für das in SKK gebrauchte „$ \Phi_{P_k}(\alpha) \in p^{k}\mathbb{S}_{\Z} $ für alle $ p $“ genügt schlicht $ \mathrm{deg} P_k \ge k $. Keine Koeffizienten-Feinabstimmung nötig.
Archimedisch kleine Werte mit Kongruenzvorgabe
Lemma – Dirichlet–Siegel mit Restklassen:
Sei $ \alpha \in \mathbb{R} \text{(endlich)} $, $ d \ge 1 $, $ M \ge 2 $ ein Modul.
Für jede vorgegebene Restklasse $ \overline{C} = (\overline{c}_{0}, \cdots , \overline{c}_{d}) \in (\mathbb{Z} / M \mathbb{Z})^{d + 1} $ und jedes $ \epsilon > 0 $ existiert ein nichttriviales $ P(x) = \sum_{i = 0}^{d} c_{i} x^{i} \in \mathbb{Z}[x] $ mit
und mit einer expliziten Höhenkontrolle $ \mathrm{max}_{i} \left| c_{i} \right| \le H(d, M, \epsilon, \alpha) $.
Beweisskizze:
Betrachte das Gitter $ \Lambda = \left\{ c \in \mathbb{Z}^{d + 1} ~\middle|~ c \equiv \overline{C} \; (\mathrm{mod} \, M) \right\} $ und die lineare Form $ L_{\alpha}(c) = \sum_{i = 0}^{d} c_{i} \alpha^{i} $. Wähle die Box
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \mathfrak{B}\;\;\;=\;\;\;\left\{ c \in \mathbb{R}^{d + 1}\;~\middle|~\;\Vert c \Vert_{\infty} \le H \right\} } \] | (SN.Tra.44) |
und wende den Satz vom Schubfach/die Geometrie der Zahlen (Dirichlet/Minkowski) auf die Bilder $ L_{\alpha}(\Lambda \cap \mathfrak{B}) $ an: Für $ H $ groß genug liegen zwei Gitterpunkte in einem Intervall der Länge $ \epsilon $; ihre Differenz $ c \in \Lambda \setminus \left\{ 0 \right\} $ erfüllt die beiden Bedingungen. Die explizite Schranke $ H(\cdot) $ ergibt sich aus den Volumina (Standard). $ \blacksquare $
Zusatz (Monizität erzwingbar): Fügt man die Kongruenz $ c_{d} \equiv 1 \;\; (\mathrm{mod} \, M) $ hinzu und wählt hinterher den eindeutigen Vertreter mit $ \left| c_{d} \right| \le M / 2 $, so ist für $ M > 2 $ bereits $ c_{d} = 1 $. Damit kann man monische $ P $ erzwingen.
Profiniter „Diagonalschritt“ $ = $ Koeffizienten stabilisieren
Lemma – Kohärente Kette $ \Rightarrow $ stationäre Koeffizienten:
Sei $ M_{1} | M_{2} | M_{3} | \cdots $ mit $ M_{k} \rightarrow \infty $.
Angenommen, es gibt eine Folge $ P_{k}(x) = \sum_{i=0}^{d_{k}} c_{i}^{(k)} x^{i} \in \mathbb{Z}[x] $ mit
Dann existieren eindeutig bestimmte Integers $ c_{i} $ mit $ c_{i}^{(k)} = c_{i} $ für alle genügend großen $ k $ (für jedes feste $ i $). Mit anderen Worten: alle Koeffizienten stabilisieren; die Folge $ (P_{k}) $ konvergiert zu einem echten ganzzahligen Polynom $ P(x) = \sum_{i} c_{i} x^{i} $.
Beweis: Fixiere $ i $. Aus $ c_{i}^{(k + 1)} \equiv c_{i}^{(k)} \; (\mathrm{mod} \, M_{k}) $ folgt $ c_{i}^{(k + 1)} − c_{i}^{(k)} = t_{k} M_{k} $ mit $ t_{k} \in \mathbb{Z} $. Wegen $ \left| c_{i}^{(k + 1)} − c_{i}^{(k)} \right| \le \left| c_{i}^{(k + 1)} \right| + \left| c_{i}^{(k)} \right| \le M_{k} $ muss $ t_{k} \in \{ −1, 0, 1 \} $. Doch $ \left| c_{i}^{(k + 1)} \right| \le M_{k + 1} / 2 $ und $ M_{k + 1} \ge 2 M_{k} $ (ggf. Modulkette so gewählt) erzwingen $ t_{k} = 0 $ für alle großen $ k $. Also stationär. $ \blacksquare $
Satz und Reduktion
Satz – Superiales Kronecker-Kriterium:
(In Arbeit …)
| ▾ | Alter, verkehrter Ansatz rein über $ p $-adische Bewertungen: |
Beweis: Nicht-Einbettung jeder transzendenten Zahl in eine einzige Ebene der Superial-Zahlen
Die vollständigen sinnvollen Koeffizienten sind die reell algebraischen Zahlen
Unser Beweis stütz sich auf die $ p $‑adische Argumentation, also auf die Idee, dass jede reell algebraische Zahl $ a \neq 0 $ über eine Zerlegung in ihre $ p $‑adischen Bewertungen $ \mathrm{v}_{\!p}(a) $ zu beschreiben ist. Bei einer algebraischen Zahl ist $ \left\{ \mathrm{v}_{\!p}(a) \neq 0 \right\} $ stets eine endliche Indexmenge (nur endlich viele Primzahlen $ p $ haben von Null verschiedene Bewertungen), und jeder Index $ \mathrm{v}_{\!p}(a) \in \mathbb{Q} $ ist rational. Genau diese Eigenschaft „endlich viele, rationale $ p $‑adische Bewertungen“ ermöglicht es, dass $ a $ durch $ a \cdot \s $ in die erste Schicht der ganzen Superial-Zahlen $ \mathbb{S}_{\Z} $ eingebettet wird.
Für transzendente Zahlen soll nun das Gegenteil gelten: Sie können nicht alleine durch Multiplikation mit $ \s $ zu einer aktual unendlichen ganzen Superial-Zahl werden, ohne eine niedrigere Schicht des superialen Stellenwertsystems mit einem Wert ungleich Null zu belegen. Das bedeutet, sie sind keine sinnvollen Koeffizienten der Superial-Zahlen, sondern selber Superial-Zahlen mit aktual unendlich kleinen Summanden.
Im Detail:
Sei die Grundlage für unseren folgenden Widerspruchsbeweis unser vorheriger
Beweis, dass alle reell algebraischen Zahlen sinnvolle Koeffizienten der Superial-Zahlen sind.
Das $ p $‑adische Grundprinzip
Unser Beweis zu den sinnvollen superialen Koeffizienten geht folgendermaßen.
$ p $‑adische Bewertung
Für jede Primzahl $ p $ und jede reell algebraische Zahl $ a \in \mathbb{A}_{\R} $ ist in der klassischen Zahlentheorie der
$ p $‑adische Betrag $ \left| a \right|_{p} $ beziehungsweise für jede $ a \in \mathbb{A}_{\R} \setminus \left\{ 0 \right\} $
die $ p $‑adische Bewertung $ \mathrm{v}_{\!p}(a) \in \mathbb{Q} $ definiert.
Grob gesagt misst $ \mathrm{v}_{\!p}(a) $ wie oft $ p $ als Faktor in $ a $ steckt.
Etwa:
| • |
Wenn $ a = p^{\delta_{p}} \times \, $ (ein $ p $‑adisch invertierbares Element), dann ist $ \mathrm{v}_{\!p}(a) = \delta_{p} $. |
| • |
Für reell algebraische $ a $ ist $ \mathrm{v}_{\!p}(a) $ eine endliche rationale Zahl (positiv, negativ oder Null), und nur finit viele $ p $ tragen tatsächlich bei ($ \mathrm{v}_{\!p}(a) \neq 0 $). |
Interpretation im Superial-System
Die Basis $ \s $ enthält pro Primzahl $ p $ $ ω $-viele Faktoren (exponentiell):
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \s\;\;\;≔\;\;\;\prod_{\substack{p \in \mathbb{P}}} p^{ω} } \] | (SN.Ein.26) |
Eine ZFC-konforme Definition der Eigenschaften unseres unendlichen Produkts der superialen Basis $ \s $ über $ p $-adische Bewertungen findet sich auf der Seite ›Die ZFC-Modellkonstruktion der Superial-Zahlen‹.
Eine unendlich große ganze Superial-Zahl in $ \mathbb{S}_{\Z} $ hat $ ω $-viele Faktoren pro Primzahl – eventuell plus eine endliche oder rationale Verschiebung. Das heißt: Jedes Produkt einer positiven reell algebraischen Zahl mit $ \s $ hat eine transfinite Primfaktorzerlegung der Form
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { a \cdot \s\;\;\;=\;\;\;\pm \prod_{\substack{p \in \mathbb{P}}} p^{ω + \mathrm{v}_{p}(a)} \;\; , } \] | (SN.Tra.47) |
wobei $ \mathrm{v}_{\!p}(a) $ für (fast) alle $ p $ Null oder ein (endlicher) rationaler Wert ist. Anders gesagt: Jede Primzahl kommt in diesem Produkt unendlich oft vor, nur mit einem kleinen rationalen Offset in der Exponentenhöhe. Und nach dem Beweis der Überrationalitätsvermutung, zusammen mit dem Abschnitt ›Ganzzahlige Potenzen der Wurzeln und ihrer Kehrwerte‹, ist jeder Primzahlturm $ p^{ω + \mathrm{v}_{p}(a)} $ eine aktual unendliche ganze Zahl, wenn $ \mathrm{v}_{p}(a) \in \mathbb{Q} $, obwohl $ ω + \mathrm{v}_{p}(a) $ eine gebrochene Zahl sein kann, weil $ ω $ so groß ist, dass ein endlicher rationaler Summand daran nichts ändert.
Warum algebraische Zahlen „aufgesaugt“ werden können
Für die höheren Schichten der ganzen Superial-Zahlen $ \mathbb{S}_{\Z} $ stellen sich die Verhältnisse wie folgt dar.
Satz
Ist $ a $ algebraisch und nicht Null, dann existieren eine (endliche!) Menge von Primzahlen $ p $,
rationale Exponenten $ \mathrm{v}_{\!p}(a) \neq 0 $ und für alle anderen $ p $ gilt $ \mathrm{v}_{\!p}(a) = 0 $.
Das ist letztlich eine Verallgemeinerung des Faktorsatzes für rationale Zahlen auf algebraische:
mittels Minimalpolynom und resultierender Faktorisierung kann man argumentieren, dass $ a $ sich $ p $‑adisch nur „endlich oft“ auswirkt,
und die $ p $‑adischen Bewertungen rational sind.
Einbettung in eine einzelne Schicht der ganzen Superial-Zahlen $ \mathbb{S}_{\Z} $ einer Potenz größer gleich Eins
Nimmt man nun $ a \cdot \s^{n} $ (für $ n \geq 1 $), also eine einzelne höhere Schicht der ganzen Superial-Zahlen,
dann ist die exponentielle $ p $-Komponente
Da ω „infinit groß“ ist, ist $ n \cdot ω $ unendlich; also hat man $ n \cdot ω \, + $ (noch etwas Rationales). Das ergibt eine Darstellung
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { a \cdot \s^{n}\;\;\;=\;\;\;\pm \prod_{\substack{p \in \mathbb{P}}} p^{n \cdot ω + \mathrm{v}_{p}(a)} \;\; , } \] | (SN.Tra.49) |
was genau in einer Schicht in $ \mathbb{S}_{\Z} $ liegt. Also: $ a $ ist ein sinnvoller Koeffizient.
Daraus folgt: Alle reell algebraischen $ a $ werden durch $ a \cdot \s^{n} $ zu ganzen Superial-Zahlen.
Widerspruch für transzendente Zahlen
Jetzt nehmen wir an (zum Ausschluss), es gäbe eine $ \tau \in \mathbb{R} $ transzendent, die doch durch ein
$ a = \tau $ ($ \tau $ genannt Tau) und ein nichtnegatives $ n $ so in $ \mathbb{S}_{\Z} $ landet, also
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \tau \cdot \s^{n}\;\;\;=\;\;\;\pm \prod_{\substack{p \in \mathbb{P}}} p^{n \cdot ω + \delta_{p}} \;\; . } \] | (SN.Tra.50) |
Daraus bekäme man (formal) eine Primfaktorzerlegung von $ \tau $ indem man „dividiert“ durch $ \s^{n} $. Klassisch auf $ p $‑adisch formuliert hieße das:
Somit
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \mathrm{v}_{\!p}(\tau)\;\;\;=\;\;\;\delta_{p} \;\;. } \] | (SN.Tra.53) |
Denn in unserer transfiniten Arithmetik von Exponenten müssten wir annehmen $ \delta_{p} $ sei rational, und es gäbe nur endlich viele Primzahlen $ p $ mit $ \delta_{p} \neq 0 $.
Das aber heißt, $ \tau $ hätte eine endliche, rationale $ p $‑adische Bewertungsmenge $ \left\{ \delta_{p} \right\} $. In der klassischen (Standard-)Mathematik würde sie also algebraisch sein, denn Transzendenz setzt voraus, dass man kein solches „endliches Rational-Profil“ an $ p $‑adischen Bewertungen findet, das $ \tau $ in eine Polynomgleichung endlicher Ordnung zwingt.
So entstünde ein Widerspruch:
| • |
$ \tau $ wäre transzendent, |
| • |
$ \tau $ hätte aber $ p $‑adische Bewertungen $ \delta_{p} \in \mathbb{Q} $ nur für endlich viele $ p $, |
| • |
was die typischen Argumente zur Algebraizität auslöst. |
Damit ist klar, dass keine echt transzendente Zahl $ \tau $ durch bloßes Multiplizieren mit $ \s^{n} $ wo (wo $ n \geq 1 $) in $ \mathbb{S}_{\Z} $ eintreten kann. Folglich ist $ \tau $ kein sinnvoller Koeffizient, wenn wir die sinnvollen Koeffizienten so definieren, dass sie via Multiplikation mit einer (positiven) Potenz $ n $ von $ \s $ zu einer ganzen Superial-Zahl werden, die auch nur in der $ n $-ten Schicht einen Wert ungleich Null erhält.
Schlussfolgerung
Die $ p $‑adische Argumentation läuft also so:
| • |
Für algebraische Zahlen $ a \neq 0 $ existiert eine endliche Indexmenge relevanter $ p $, der $ \mathrm{v}_{\!p}(a) \neq 0 $. Jeder $ \mathrm{v}_{\!p}(a) $ ist rational. Dann ist $ a \cdot \s^{n} $ in $ \mathbb{S}_{\Z} $. |
| • |
Für transzendente Zahlen $ \tau $ kann $ \tau \cdot \s^{n} $ keinesfalls in $ \mathbb{S}_{\Z} $ liegen, da man sonst eine endliche Primfaktorzerlegung mit rationalen Exponenten konstruieren könnte (aus $ \mathrm{v}_{\!p}(\tau) = \delta_{p} $), was $ \tau $ zurück in eine algebraische Zahl verwandeln würde – ein Widerspruch. |
Diese $ p $‑adische Sicht bildet damit genau das Fundament für:
Alle und nur reell algebraische Zahlen sind in der Lage, durch Multiplikation mit einer nichtnegativen Potenz von $ \s $ in eine einzige aktual unendliche Schicht der ganzen Zahlen $ \mathbb{S}_{\Z} $ der Superial-Zahlen überzugehen.
Damit ist die transzendente Zahl $ \tau $ als sinnvoller Koeffizient ausgeschlossen. Sobald man $ \tau $ doch im superialen Stellenwertsystem repräsentieren will, muss man auf negative Potenzen zurückgreifen.
Wir sehen auch hier wieder, dass die Superial-Zahlen in der Zahlentheorie eine außergewöhnliche Bedeutung haben.
Sie fungieren als Lupe, die uns erlaubt in tiefe aktual unendliche Feinstrukturen der reellen Zahlen hineinzublicken. Wodurch sie unser Verständnis der algebraischen Zahlen weiter erhellen und besonders auch zum weiteren Verständnis der transzendenten Zahlen beitragen, siehe die Abgrenzung zwischen algebraischen und transzendenten Zahlen und konkret die eulersche Zahl $ \e_{\s} $, und sicher noch weiter beitragen werden. Denn sie geben uns einen intuitiv nachvollziehbaren Grund dafür, warum dies alles so ist. Den finden wir in der arithmetischen Struktur der Geometrie, die uns wieder über den Überrationalitätsvermutung und deren Beweis zu einem neuen Verständnis aktual unendlich feiner Raster und deren Zusammenhang mit irrationalen Wurzeln führt.
Erst dieses neue Verständnis der irrationalen Wurzeln und ihre überrationale Darstellung mittels aktual unendlich feiner Raster ermöglicht uns schließlich alle algebraischen Zahlen als auf diesem Raster liegend zu begreifen. Was uns wiederum erkennen lässt, dass es sich bei den transzendenten Zahlen tatsächlich um echte superiale Zahlen oder, wie im Fall der eulersche Zahl $ \e_{\s} $, sogar noch um deren Erweiterungen handeln muss.
X
(In Arbeit …)
Wenn transzendente Zahlen superial kleine Summanden besitzen, dann sind es zum Beispiel Zahlen der Form:
Sie müssten demnach folglich Elemente der Menge der reellen Zahlen $ \mathbb{R} $ sein.
Wenn dem so ist, dann X:
(In Arbeit …)
(In Arbeit …)
| → |
Fußnoten |
|
| 1. |
(Primärliteratur einfügen!) Sekundärliteratur: Vgl. Bischoff, Wie wurde die eulersche Zahl entdeckt?. Internet: Vgl. Wikipedia, Eulersche Zahl. | |
| 2. |
(Primärliteratur einfügen!) Sekundärliteratur: Vgl. Bischoff, Wie wurde die eulersche Zahl entdeckt?. Internet: Vgl. Wikipedia, Eulersche Zahl. | |
| 3. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Kongruenz, Restklassen. | |
| 4. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Kongruenz. | |
| 5. |
(Primärliteratur einfügen!) Sekundärliteratur: Vgl. Bischoff, »Tausend Seiten Beweis«. Internet: Vgl. Wikipedia, Langlands-Programm. | |
| 6. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, P-adische Zahl, Konstruktion, Analytische Konstruktion, Exponentenbewertung. |
| |
Stand 20. November 2025, 23:00 CET.
-
Permanente Links:
(Klicke auf die Archivlogos
zum Abruf und Ansehen
der Archive dieser Seite.) -

-
archive.todaywebpage capture