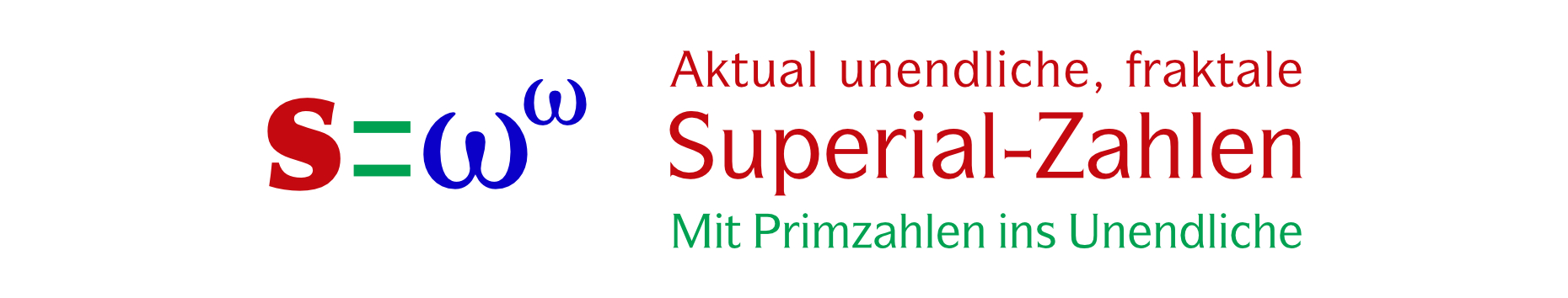| ← |
Algebraische-Koeffizienten-Vermutung (AKV)
Wir vermuten, dass alle sinnvollen superialen Koeffizienten exakt den reell algebraischen Zahlen entsprechen
Die Trennlinie zwischen den reell algebraischen Zahlen und den transzendenten Zahlen entspricht im Grunde der Trennlinie zwischen den Fraktalebenen der Superial-Zahlen
Um die Trennlinie zwischen den reell algebraischen Zahlen und den transzendenten Zahlen im Rahmen der Superial-Zahlen zu verstehen, müssen wir erkennen, dass sich wichtige Eigenschaften der transzendenten Zahlen im Superial-Universum anders darstellen, als sie in der klassischen Mathematik gesehen werden.
Neue Sicht der transzendenten Zahlen
Ein Paradigmenwechsel
Aus Sicht der klassischen Mathematik enthalten transzendente Zahlen keine unendlich kleinen Summanden. Dies kommt, weil in ihr transzendente Zahlen durch Grenzwertbetrachtungen mit Hilfe des Limes definiert sind.
Bei Grenzwertbetrachtungen wird das Verhalten von Funktionen untersucht, wenn sich ihr Parameter einem bestimmten Wert, von unten oder von oben, nähert oder in Richtung Unendlichkeit läuft. Das bedeutet aber eben auch, dass die Werte der Parameter nie wirklich das Endliche verlassen, wodurch dann keine wirklich unendlich kleinen Summanden bei der Annäherung der Funktion an einen Grenzwert entstehen können.
Im Superial-Universum sieht die Sache nun anders aus. Die Parameterwerte sind hier wirklich aktual unendlich große oder kleine Superial-Zahlen. Dadurch bekommen transzendente Zahlen echte unendlich kleine Summanden, auch, wenn ihr führender oder bestimmender Wert im Endlichen verbleibt. Dies ist die Superiale-Transzendenz-Vermutung, die ich später noch beweisen möchte.
Sie stellt einen tief gehenden grundsätzlichen Paradigmenwechsel dar, der uns eine Lupe in die feinen Strukturen der Transzendenz an die Hand gibt. Diese ermöglicht uns ganz neue Einblicke, wie wir bei der superialen Eulerschen Zahl $ \e_{\s} $ und der superialen Zahl $ π_{\s} $(Link) sehen.
Neue Sicht auf die reell algebraischen Zahlen
In vielem unverändert und doch ein echter Paradigmenwechsel
Rationale Zahlen
Ganzzahlige Brüche
Jede rationale Zahl ist im Produkt mit $ \s $ aufgrund seiner Primzahlstruktur ganz offensichtlich immer eine aktual unendlich große ganze Zahl.
Radikale
Natürliche Wurzeln aus natürlichen Zahlen
Zunächst ist durch die Überrationalitätsvermutung und ihren Beweis ein neues Verständnis eines wichtigen Teils der reell algebraischen Zahlen, nämlich den Radikalen – ganzzahligen Wurzeln aus positiven natürlichen Zahlen –, gelungen:
Unter den Radikalen befinden sich auch irrationale Zahlen, wie die Wurzel aus Zwei, also $ \left| \sqrt{2} \,\right| = 2^{½} $. Solche Zahlen sind, genauer ausgedrückt, gebrochene Zahlen mit unendlich vielen nicht periodischen Nachkommastellen. Noch genauer betrachtet stellt sich die Frage: Sind diese Nachkommastellen vom Wert her alle endlich groß?
Der Beweis der Überrationalitätsvermutung zeigt, dass sich diese irrationalen Radikale in jede Schicht des Stellenwertsystems der Superial-Zahlen vollständig eingliedern. Das zeigt sich durch eine neue und in diesem Zusammenhang sinnvolle Beantwortung der Frage, durch welchen ganzzahligen Bruch wir die Wurzel aus Zwei oder jedes andere Radikal darstellen können:
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \left| \sqrt{ 2 } \,\right|\;\;\;=\;\;\;2^{\frac{ 1 }{ 2 }}\;\;\;=\;\;\;\frac{ 2^{\frac{ 1 }{ 2 }} \cdot 2^{ω} }{ 2^{ω} } } \] | (SN.ÜV.28) |
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \left| \sqrt[x]{ n } \,\right|\;\;\;=\;\;\;n^{\frac{ 1 }{ x }}\;\;\;=\;\;\;\frac{ n^{\frac{ 1 }{ x }} \cdot \rad(n)^{ω} }{ \rad(n)^{ω} } } \] | (SN.SinK.R.24) |
Der Beweis mündet in die beispielhafte Formel SN.ÜV.28 und die allgemeine Formel SN.SinK.R.24. Er zeigt, dass für die Frage, wie kann jede ganzzahlige Wurzel aus einer positiven natürlichen Zahl als ganzzahliger Bruch darstellen werden, im Endlichen keine Antwort existiert. Diese Antwort gibt es nur mit aktual unendlich großem Nenner und Zähler, sehen wir nun im Beweis.
Wenn man naiv auf beide Formeln schaut, dann könnte man argumentieren, dass diese doch nicht abschließend sind, weil sie noch gekürzt werden können. Jedoch ist dies nicht ganz korrekt: Wenn wir nämlich vollständig kürzen, dann ist die Bedingung der Ganzzahligkeit von Nenner und Zähler nicht mehr gegeben, weil die aktuale Unendlichkeit verloren geht, die der Beweis fordert. Einzig endlich oft kürzen ist möglich, ohne diese Bedingung zu verletzen, bringt aber keinerlei zusätzlichen Gewinn.
Diese Erkenntnis eröffnet eine ganz neue Perspektive auf die sinnvollen Koeffizienten der Superial-Zahlen. Denn die Faktoren $ 2^{ω} $ und allgemeiner $ \rad(n)^{ω} $ sind auch Teil des Primzahlflächenprodukts von $ \s $. Dadurch wird jedes Produkt einer Wurzel mit unserer superialen Basis
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { n^{\frac{1}{x}} \cdot \s\;\;\;\in\;\;\;\mathbb{S}_{\N,\{ 1 \}}^{+} } \] | (SN.SinK.R.26) |
zu einer unendlich großen natürlichen Zahl, in der nur die Exponentenschicht $ \s^{1} $ belegt ist. Die Schreibweise $ \mathbb{S}_{\{ 1 \}} $ begrenzt die Exponentenschichten mit Koeffizienten, die nicht Null sein können, siehe ›Eingrenzung der Schichten der Superial-Zahlen‹. Das ist ein echter Paradigmenwechsel des Verständnisses von Wurzeln und der Superial-Zahlen.
Genau diese Eigenschaft macht sinnvolle Koeffizienten aus. Denn so lassen sich die natürlichen Zahlen $ \mathbb{N} $ und auch die ganzen Zahlen $ \mathbb{Z} $ zu natürlichen Superial-Zahlen $ \mathbb{S}_{\N} $ und ganzen Superial-Zahlen $ \mathbb{S}_{\Z} $ erweitern, dass in Summen von superialen Integralen unendlich kleine Flächenelemente ganzer Anzahl gezählt und zu endlichen Flächeninhalten addiert werden können.
Alle Radikale können aus der klassischen $ p $‑adischen Sichtweise durch ihre $ p $‑adischen Bewertungen dargestellt werden, was offensichtlich ist und worauf wir gleich noch zurückkomme.
Algebraische Radikalformen
Reell algebraische Zahlen, die durch algebraische Ausdrücke mit Wurzeln dargestellt werden können
Alle algebraischen Radikalformen sind sinnvolle Koeffizienten der Superial-Zahlen. Diese sind Summen oder Produkte von Wurzeln und deren ganzzahligen Potenzen sowie geschachtelte Wurzelausdrücke aus Summen und deren Kehrwerte.
Dazu gehört zum Beispiel auch der Goldene Schnitt
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { φ\;\;\;=\;\;\;\frac{ \left| \sqrt{ 5 } \,\right| + 1 }{ 2 } } \] | (SN.SinK.SR.7) |
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { 5^{\frac{ 1 }{ 2 }} \cdot \frac{ \s }{ 2 } + \frac{ \s }{ 2 }\;\;\;\in\;\;\;\mathbb{S}_{\N,\{ 1 \}} \;\; , } \] | (SN.SinK.SR.13) |
wie auch die pythagoreischen Tripel in quadratischer oder allgemeiner Form.
Radikal-Abgeschlossenheit
Wie wir auf der Seite der sinnvollen Koeffizienten herausarbeiten, erreichen wir schließlich die Radikal-Abgeschlossenheit der Koeffizienten. Dies legen wir dort im Abschnitt ›Alle Radikalformen sind sinnvolle Koeffizienten der Superial-Zahlen‹ dar. Ein entscheidender Schritt zur Vorbereitung unseres Beweises, dass wirklich alle reell algebraischen Zahlen als Koeffizienten sinnvoll sind.
Und diesen Beweis wollen wir nun angehen.
Beweis der Ganz-Abgeschlossenheit von $ \mathbb{A}_{\S} $
Um den gesuchten Beweis zu führen, habe ich, neben eigenen Ansatzideen und dazugehörigen Recherchen, auch ChatGPT 5 Thinking um Ideen dazu befragt. Nachfolgend nun der so gefundene Beweis, dessen Ansatz und Vorgehensweise ich, zum besseren Verständnis, vorab darlege.
Glossar
| • |
endliche Primzahl: eine Primzahl $ p \in \mathbb{P} = \left\{ 2, 3, 5, \cdots \right\} $ aus $ \mathbb{N} $, als Element in $ \mathbb{S}_{\Z} $ eingebettet. |
| • |
superiale Primzahl: Primelement in $ \mathbb{S}_{\Z}\!: \; p_{\s} \ne 0 $, $ p_{\s} $ keine Einheit, und $ p_{\s} \mid ab \;\Leftrightarrow\; p_{\s} \mid a \; $ oder $ \; p_{\s} \mid b \; $. („aktual unendliche Primzahl“ in unserer Sprache.) |
| • |
Primideal: primes Ideal (zum Beispiel $ p \mathbb{S}_{\Z} $, $ ⟨p_{\s}⟩ $). |
Hinweis: „aktual unendlich“ bezieht sich hier auf die Skala/Basis $ \s $. Bei „superialer Primzahl“ meinen wir ringtheoretische Primheit in $ \mathbb{S}_{\Z} $, nicht unbedingt „unendlich große“ numerische Größe.
Terminologie
Im Folgenden bedeutet „Primzahl“ stets endliche Primzahl (das heißt eine Primzahl aus $ \mathbb{Z} $). Unter „superialer Primzahl“ verstehen wir ein Primelement in $ \mathbb{S}_{\Z} $ (aktual-unendliche Primzahl). Bewertungen $ v_{p} $, Ideale $ p \mathbb{S}_{\Z} $ und alle Teilbarkeitsaussagen sind über endliche Primzahlen $ p $ indiziert.
Unser Ansatz und Vorgehen
Als Ansatz trennen wir zuerst bei jeder ganzen Superial-Zahl $ X \in \mathbb{S}_{\Z} $ den „allgemeinen $ \s $-Vorrat“ an unendlich vielen endlichen Primzahlen von der eigentlichen arithmetischen Information. Weil $ \s $ alle Primzahlen „trägt“, kann man $ X $ eindeutig als $ X = \s^{m} \cdot X^{(0)} $ schreiben. Der Faktor $ \s^{m} $ steht für die beliebige Menge an Primpotenzen, die ohnehin in $ \s $ stecken; der $ \s $-primitive Teil $ X^{(0)} $ beginnt auf der $ \s^{0} $-Stelle und hat damit einen nichtverschwindenden Nullstellen-Koeffizienten. Wenn wir über „endliche Primunterstützung“ sprechen, meinen wir immer die des $ \s $-primitiven Teils — genau dort sitzt die zusätzliche, endliche Primstruktur.
Als nächstes führen wir für jede Primzahl $ p $ eine „$ p $-Exponentenfunktion“ $ v_{p} $ auf dem Quotientenkörper $ \mathbb{S}_{\Q} = \mathrm{Frac}(\mathbb{S}_{\Z}) $ ein: Sie misst, wie oft $ p $ in Zähler minus Nenner vorkommt. Diese $ v_{p} $ verhalten sich wie bekannte $ p $-adische Bewertungen (additiv über Produkte, ultrametrisch über Summen). Damit definieren wir zu jedem $ p $ den Bewertungsring $ V_{p} = \left\{ x \in \mathbb{S}_{\Q} ~\middle|~ v_{p}(x) \ge 0 \right\} \cup \left\{ 0 \right\} $. Solche Ringe sind lokal und (klassisch) ganz abgeschlossen; außerdem gilt für jedes $ x $: entweder $ x $ oder $ x^{-1} $ liegt in $ V_{p} $.
Nun der Kernschritt: Wir zeigen $ \mathbb{S}_{\Z} = \bigcap_{p} V_{p} $. Die Inklusion „$ \subseteq $“ ist klar, denn eine ganze Superial-Zahl hat nirgendwo negative $ v_{p} $-Exponenten. Für „$ \supseteq $“ nehmen wir $ x $ aus dem Schnitt, schreiben $ x = X / Y $ mit $ X, Y \in \mathbb{S}_{\Z} $ und faktorieren zuerst alle $ \s $-Anteile heraus: $ X = \s^{a} X^{(0)}, Y = \s^{b} Y^{(0)} $. Der $ \s $-Teil ist selbst in $ \mathbb{S}_{\Z} $, daher reicht es, den Quotienten $ X^{(0)} / Y^{(0)} $ zu verstehen. Weil $ x $ in jedem $ V_{p} $ liegt, ist für alle $ p $ die $ p $-Exponentenzahl des Zählers mindestens so groß wie die des Nenners. Da $ Y^{(0)} $ nur endlich viele Primteiler hat, können wir aus diesen endlich vielen $ p $ einen gemeinsamen Divisor $ D $ (tatsächlich eine ganze Zahl) bauen, der $ Y^{(0)} $ teilt — und wegen der Ungleichungen auch $ X^{(0)} $. Nach dem Teilen bleibt im Nenner ein Element ohne positive $ p $-Exponenten übrig, also eine Einheit; damit ist $ X^{(0)} / Y^{(0)} \in \mathbb{S}_{\Z} $, folglich auch $ x \in \mathbb{S}_{\Z} $. So steht die Gleichheit $ \mathbb{S}_{\Z} = \bigcap_{p} V_{p} $.
Aus dieser Darstellung folgt sofort:
$ \mathbb{S}_{\Z} $ ist der Schnitt ganz abgeschlossener Ringe und daher selbst ganz abgeschlossen.
Genau das brauchen wir für den Schritt zu allen reell algebraischen Zahlen:
Ist $ \alpha $ reell algebraisch (Nullstelle eines monischen Polynoms mit ganzzahligen Koeffizienten), setze $ Y = \alpha \cdot \s $ und multipliziere die Gleichung passend mit einer Potenz von $ \s $.
Dann erfüllt $ Y $ eine monische Gleichung mit Koeffizienten in $ \mathbb{S}_{\Z} $, ist also ganz über $ \mathbb{S}_{\Z} $.
Wegen der Ganzabgeschlossenheit liegt $ Y $ tatsächlich in $ \mathbb{S}_{\Z} $.
Per Definition von „sinnvoll“ heißt das:
$ \alpha = Y / \s $ gehört zu $ \mathbb{A}_{\S} $.
In Summe:
(i) $ \s $-Vorrat ausklammern und nur den $ \s $-primitiven Teil arithmetisch betrachten,
(ii) $ \mathbb{S}_{\Z} $ als Schnitt der $ p $-Bewertungsringe identifizieren $ \Leftrightarrow \mathbb{S}_{\Z} $ ist ganz abgeschlossen,
(iii) daraus folgt mit einem einzigen Ganzheitsargument, dass jede reell algebraische Zahl ein sinnvoller Koeffizient ist.
Der beschriebene Ansatz und unser Vorgehen wird nachfolgend im Detail ausgearbeitet und damit der Beweis vorgelegt, dass wirklich alle reell algebraischen Zahlen sinnvolle Koeffizienten der Superial-Zahlen sind.
Stehende Annahmen (SA)
Unsere Annahmen noch einmal kurz zusammengefasst:
Inklusionen: $ \mathbb{Z} \subset \mathbb{A}_{\S} $ und $ \mathbb{Z} \subset \mathbb{S}_{\Z} $.
Für $ n \ge 1 $ gilt $ \s^{n} \mathbb{A}_{\S} \subset \mathbb{S}_{\Z} $.
Für $ n = 0 $ gilt $ \s^{0} \mathbb{A}_{\S} \not\subset \mathbb{S}_{\Z} $.
Denn wegen $ \s^{0} = 1 $ und $ \mathbb{A}_{\S} = 1 \cdot \mathbb{A}_{\S} $ gilt dann eben im Allgemein $ \mathbb{A}_{\S} \not\subset \mathbb{S}_{\Z} $.
Begründung: Koeffizient $ a $ heißt „sinnvoll“, wenn er nur die $ n $-te Exponentenschicht verändert, in der er Faktor ist, also $ a \in \mathbb{A}_{\S} \Leftrightarrow a \cdot \s^{n} \in \mathbb{S}_{\Z,\{ n \}} $, mit $ n \ge 1 $. (Schreibweise $ \mathbb{S}_{\Z,\{ n \}} $ siehe Abschnitt ›Eingrenzung der Schichten der Superial-Zahlen‹.) Jedoch sind in der nullten Exponentenschicht ($ n = 0 $) der ganzen Superial-Zahlen $ \mathbb{S}_{\Z} $ nur ganze Zahlen aus $ \mathbb{Z} $ erlaubt, also nicht alle sinnvollen Koeffizienten $ \mathbb{A}_{\S} $.
Integritätsbereich: $ \mathbb{S}_{\Z} $ ist also Integritätsbereich mit $ \mathbb{Z} \subset \mathbb{S}_{\Z} $ und ausgezeichnetem Element $ \s \in \mathbb{S}_{\Z} $. Der Quotientenkörper sei
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \s\;\;\;\in\;\;\;\mathbb{S}_{\Q}\;\;\;≔\;\;\;\mathrm{Frac}(\mathbb{S}_{\Z}) \;\; . } \] | (SN.AKV.1) |
Primzahldivisoren: Für jede Primzahl $ p \in \mathbb{P} $ ist $ p \mathbb{S}_{\Z} $ ein Primideal; ferner gilt
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \bigcap_{e \ge 0} p^{e} \mathbb{S}_{\Z}\;\;\;=\;\;\;\left\{ 0 \right\} \;\; . } \] | (SN.AKV.2) |
Endliche Primunterstützung relativ zum $ \s $-Vorrat:
(a) $ \s $ ist durch jede Primzahl teilbar (für alle Primzahlen $ p $ gilt $ p \mid \s $).
(b) Für jedes $ 0 \ne X \in \mathbb{S}_{\Z} $ definieren wir den $ \s $-primitiven Teil $ X^{(0)} $ über die $ \s $-Ordnung
mittels $ X = \s^{\mathrm{ord_{s}}(X)} \cdot X^{(0)} $ und $ \mathrm{ord_{s}}(X^{(0)}) = 0 $.
(c) Die Primunterstützung eines Elements meint fortan die des $ \s $-primitiven Teils:
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \mathrm{Supp}_{p}(X)\;\;\;≔\;\;\;\left\{\; p \in \mathbb{P}\;~\middle|~\;v_{p}(X^{(0)}) > 0 \;\right\} } \] | (SN.AKV.4) |
Diese Menge ist endlich.
(d) Für alle $ n \ge 1 $ gilt $ \s^{n}\mathbb{A}_{\S} \subset \mathbb{S}_{\Z} $; allgemein $ \mathbb{A}_{\S} \not\subset \mathbb{S}_{\Z} $ (wohl aber $ \mathbb{Z} \subset \mathbb{A}_{\S} $ und $ \mathbb{Z} \subset \mathbb{S}_{\Z} $).
Kommentar: Die „unendliche“ Primdichte steckt vollständig im Faktor $ s^{ord_{s}}(X) $. Aussagen über „endliche Primunterstützung“ beziehen sich immer auf $ X^{(0)} $ (d. h. auf die zusätzliche, von $ \s $ unabhängige Primstruktur).
Bewertungen und Valuationsringe
Wir definieren unsere $ p $-adischen Bewertung und den Valuationsring:
Bewertungen $ v_{p} $:
Für $ 0 \ne X \in \mathbb{S}_{\Z} $ setze
Für $ x = X / Y \in \mathbb{S}_{\Q}^{\times} $ mit $ X, Y \in \mathbb{S}_{\Z} $, $ Y \ne 0 $ setze
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { v_{p}(x)\;\;\;≔\;\;\;v_{p}(X) − v_{p}(Y)\;\;\;\in\;\;\;\mathbb{Z} \;\; . } \] | (SN.AKV.7) |
Axiom 0: Die Bewertungen $ v_{p} $ sind wohldefiniert und erfüllen für $ x, y \in \mathbb{S}_{\Q}^{\times} $.
Axiom 1: $ v_{p}(xy) = v_{p}(x) + v_{p}(y) $
Axiom 2: $ v_{p}(x + y) \ge \mathrm{min}\{v_{p}(x), v_{p}(y) \} $, falls $ x + y \ne 0 $
Axiom 3:
Für $ n \in \mathbb{Z} \setminus \{ 0 \} $ stimmt $ v_{p}(n) $ mit der üblichen $ p $-Adik überein.
Beweis: Standard über Ideale $ p^{e}\mathbb{S}_{\Z} $ und stehende Annahmen (SA).
Valuationsring $ V_{p} $:
Setze
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { V_{p}\;\;\;≔\;\;\;\left\{\; x \in \mathbb{S}_{\Q}\;~\middle|~\;v_{p}(x) \ge 0 \;\right\} \cup \{ 0 \} \;\; . } \] | (SN.AKV.8) |
Struktur von $ V_{p} $:
$ V_{p} $ ist ein lokaler Valuationsring mit maximalem Ideal $ m_{p} = \left\{ x ~\middle|~ v_{p}(x) > 0 \right\} \cup \left\{ 0 \right\} $.
Insbesondere ist $ V_{p} $ ganz abgeschlossen.
Beweis: Aus Axiomen; Klassik: Valuationsringe sind ganz abgeschlossen.
Schnittdarstellung von $ \mathbb{S}_{\Z} $
Wir können die Menge der ganzen Superial-Zahlen als Schnitt unseres Valuationsrings charakterisieren:,
Lemma – Offensichtliche Inklusion: $ \mathbb{S}_{\Z} \subseteq \bigcap_{p} V_{p} $.
Beweis: Für $ X \in \mathbb{S}_{\Z} \setminus \{ 0 \} $ ist $ v_{p}(X) \ge 0 $ für alle $ p $.
Bemerkung – Einheitenkriterium: Für $ 0 \ne U \in \mathbb{S}_{\Z} $ gilt: $ U $ ist Einheit $ \Leftrightarrow v_{p}(U) = 0 $ für alle $ p $.
Begründung: Hat $ v_{p}(U) \ge 1 $ für ein $ p $, dann teilt $ p $ das Hauptideal $ U \mathbb{S}_{\Z} $, also ist $ U $ keine Einheit; umgekehrt folgt aus $ v_{p}(U) = 0 $ für $ \forall p $ per SA Einheitlichkeit.
Schnitt – Charakterisierung via Schnitt:
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \mathbb{S}_{\Z}\;\;\;=\;\;\;\bigcap_{ p } V_{p}\;\;\;\subset\;\;\;\mathbb{S}_{\Q} \;\; . } \] | (SN.AKV.9) |
Beweis: „$ \subseteq $“ ist klar, denn für $ X \in \mathbb{S}_{\Z} \setminus \left\{ 0 \right\} $ gilt $ v_{p}(X) \ge 0 $ für $ \forall p $. Für „$ \supseteq $“ sei $ x \in \bigcap_{p} V_{p} $. Wähle $ x = X / Y $ mit $ X, Y \in \mathbb{S}_{\Z} $, $ Y \ne 0 $. Schreibe gemäß Endliche Primunterstützung relativ zum $ \s $-Vorrat
Dann, für die endlich vielen $ p $,
Dann teilt $ D $ sowohl $ Y^{(0)} $ als auch $ X^{(0)} $. Schreibe $ X^{(0)} = D \cdot X′ $ und $ Y^{(0)} = D \cdot Y′ $.
Für $ \forall p $ gilt nun $ v_{p}(Y′) = 0 $; nach dem Einheitenkriterium (Einheitenkriterium) ist $ Y′ $ Einheit in $ \mathbb{S}_{\Z} $. Daher
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \frac{ X^{(0)} }{ Y^{(0)} }\;\;\;=\;\;\;\frac{ X′ }{ Y′ } \in \mathbb{S}_{\Z} \;\; , } \] | (SN.AKV.14) |
und folglich $ x \in \mathbb{S}_{\Z} $. $ \blacksquare $
Korrelation – Ganz abgeschlossen: Als Schnitt ganz abgeschlossener Ringe $ V_{p} $ ist $ \mathbb{S}_{\Z} $ selbst ganz abgeschlossen.
Reell algebraische Zahlen in $ \mathbb{A}_{\S} $
Nun zeigen wir, dass wirklich alle reell algebraischen Zahlen in $ \mathbb{A}_{\S} $ liegen.
Schlüssel-Proposition: Ist $ \mathbb{S}_{\Z} $ in $ \mathbb{S}_{\Q} $ ganz abgeschlossen (Korrelation – Ganz abgeschlossen), dann gilt:
Jede reell algebraische Zahl $ \alpha $ liegt in $ \mathbb{A}_{\S} $.
Beweis: Sei $ \alpha $ reell algebraisch, Nullstelle eines monischen Polynoms
Setze $ Y ≔ \alpha \cdot \s $ und multipliziere mit $ \s^{n} $:
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Leftrightarrow\hspace{10mm}\alpha^{n} \s^{n} + a_{n - 1} \alpha^{n - 1} \s^{n} + \cdots + a_{1} \alpha \s^{n} + a_{0} \s^{n}\;\;\;=\;\;\;0 } \] | (SN.AKV.16) | ||
| |||
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Leftrightarrow\hspace{10mm}\alpha^{n} \s^{n} + a_{n - 1} \s \alpha^{n - 1} \s^{n - 1} + \cdots \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \cdots + a_{1} \s^{n - 1} \alpha \s + a_{0} \s^{n}\;\;\;=\;\;\;0 } \] | (SN.AKV.17) | ||
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Leftrightarrow\hspace{10mm}\left( \alpha \cdot \s \right)^{n} + \left( a_{n - 1} \s \right) \left( \alpha \cdot \s \right)^{n - 1} + \cdots \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \cdots + \left( a_{1} \s^{n - 1} \right) \left( \alpha \cdot \s \right) + a_{0} \s^{n}\;\;\;=\;\;\;0 } \] | (SN.AKV.18) | ||
| |||
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Leftrightarrow\hspace{10mm}Y^{n} + \left( a_{n - 1} \s \right) Y^{n - 1} + \cdots + \left( a_{1} \s^{n - 1} \right) Y + a_{0} \s^{n}\;\;\;=\;\;\;0 \;\; . } \] | (SN.AKV.19) | ||
Hier liegen alle Koeffizienten in $ \mathbb{S}_{\Z} $, denn $ \mathbb{Z} \subset \mathbb{S}_{\Z} $ und $ \s^{m} \in \mathbb{S}_{\Z} $ für $ \forall m \in \mathbb{N} $. Also ist $ Y $ ganz über $ \mathbb{S}_{\Z} $. Da $ \mathbb{S}_{\Z} $ ganz abgeschlossen ist, folgt $ Y \in \mathbb{S}_{\Z} $; folglich $ \alpha = Y / \s \in \mathbb{A}_{\S} $ (per Definition von $ \mathbb{A}_{\S} $). $ \blacksquare $
Fazit: Zusammen mit der bereits bewiesenen Radikal-Abgeschlossenheit von $ \mathbb{A}_{\S} $ liefert die Schlüssel-Proposition:
Alle reell algebraischen Zahlen gehören zu den sinnvollen Koeffizienten $ \mathbb{A}_{\S} $.
Also ist
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \boxed{\;\; \mathbb{A}_{\R}\;\;\;\subseteq\;\;\;\mathbb{A}_{\S} \;\;} \;\; , } \] | (SN.AKV.20) |
was zu beweisen war.
Damit haben wir tatsächlich unser bemerkenswertes Ziel erreicht zu zeigen, dass wirklich alle reell algebraischen Zahlen sinnvolle Koeffizienten der Menge der Superial-Zahlen sind.
Randbemerkung zur $ \s $-Ordnung, zum $ \s $-primitiven Teil und zur Endlichkeit
Wie können wir verstehen, was wir bewiesen haben?
Bemerkung – Struktur in Stellenschreibweise:
Warum ist SA Endliche Primunterstützung plausibel?
Jedes $ X \in \mathbb{S}_{\Z} $ hat eine endliche Stellendarstellung
Mit
erhalten wir die Zerlegung
Der $ \s^{0} $-Koeffizient von $ X^{(0)} $ ist ungleich $ 0 $ (und kann in $ \mathbb{A}_{\S} $ liegen). Da $ \s $ alle Primzahlen trägt, hängt die endliche Primunterstützung von $ X $ ausschließlich von $ X^{(0)} $ ab; beim Addieren/Multiplizieren vereinigen sich jeweils nur die endlichen Unterstützungen der $ \s $-primitiven Teile.
Dabei hat in $ \mathbb{S}_{\Z} $ nur die Nullte Stelle einen ganzzahligen Koeffizienten; alle positiven Stellen tragen sinnvolle Koeffizienten aus $ \mathbb{A}_{\S} $.
| • |
Für $ z \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{S}_{\Z} $ sind die Primteiler endlich (klassisch). |
| • |
Für jedes $ a_{i} \in \mathbb{A}_{\S} $ gilt per Definition $ a_{i} \cdot \s \in \mathbb{S}_{\Z} $; damit hat auch $ a_{i} \s^{i} = (a_{i} s) \s^{i−1} \in \mathbb{S}_{\Z} $ eine endliche Prim-Unterstützung (in der in den Superial-Zahlen benutzten p-adischen Exponentenbuchführung). |
| • |
Summe und Produkt vereinen jeweils nur endlich viele Primteiler. |
Deshalb besitzt jedes $ X \in \mathbb{S}_{\Z} $ nur endlich viele Primteiler (SA Endliche Primunterstützung relativ zum $ \s $-Vorrat), welche damit kompatibel mit der bestehenden Arithmetik in den Superial-Zahlen und den Beweisen oben ist.
| ▾ | Alter, verkehrter Ansatz rein über $ p $-adische Bewertungen: |
Der Beweis unserer Überrationalitätsvermutung, das Zeigen, dass auch alle damit sich ergebenden durch Radikale darstellbaren reell algebraischen Zahlen sinnvolle Koeffizienten der Superial-Zahlen sind, und der Beginn des systematischen Herausarbeitens der Struktur der transzendenten Zahlen, aus Perspektive des Superial-Zahlensystems, führt beinahe zwangsläufig zu dem Eindruck, dass alle reell algebraischen Zahlen sinnvolle Koeffizienten der Superial-Zahlen sein sollten.
Ein möglicher Ansatz, dies zu Beweisen, stützt sich darauf, die klassische $ p $‑adische Sichtweise auf reell algebraische Zahlen zu nutzen und diese global zu vereinen. Konkret könnte man folgendermaßen vorgehen:
| • |
p‑adische Bewertungen nutzen: |
| • |
Globale transfinite Darstellung: |
Wäre dieser Ansatz erfolgreich, so ließe sich – basierend auf den $ p $‑adischen Eigenschaften – zeigen, dass nicht nur die durch Radikale darstellbaren, sondern alle reell algebraischen Zahlen in unser Superial-Zahlensystem eingebettet werden können. Das wäre ein eleganter Beweis dafür, dass der Koeffizientenbereich $ \mathbb{A}_{\S} $ wesentlich umfassender ist als zunächst vermutet.
Diese Idee verbindet klassische algebraische Methoden ($ p $‑adische Bewertungen, Primfaktorzerlegung mit der neuen transfiniten oder aktual unendlichen Struktur der Superial-Zahlen und erscheint als vielversprechender Ansatz, um die Frage systematisch anzugehen.
Beweis: Einbettung reell algebraischer Zahlen in das System der Superial-Zahlen
Wir versuchen einen Beweisansatz – unter der Annahme, dass wir in unserem Superial-System eine transfinite Exponentenarithmetik definieren, in der ein endlicher Offset zu $ ω $ (also $ ω + q $ mit $ q \in \mathbb{ℚ} $ und $ q \neq 0 $) als von $ ω $ verschieden erkannt wird. Dann gilt:
Sei $ a \neq 0 $ eine reell algebraische Zahl, also $ a \in \mathbb{A}_{\R} \setminus \left\{ 0 \right\} $.
Für jede Primzahl $ p $ existiert die $ p $-adische Bewertung
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \mathrm{v}_{\!p}(a)\;\;\;\in\;\;\;\mathbb{Q} } \] | (SN.Alg.1) |
sodass klassisch
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { a\;\;\;=\;\;\;\pm \prod_{\substack{p \in \mathbb{P}}} p^{\mathrm{v}_{p}(a)} \;\; , } \] | (SN.Alg.2) |
wobei für fast alle Primzahlen $ p $ gilt $ \mathrm{v}_{\!p}(a) = 0 $.
Wir definieren in unserem erweiterten transfiniten System für jede Primzahl $ p $ den transfiniten Exponenten
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \mathrm{V}_{\!p}(a)\;\;\;≔\;\;\;ω + \mathrm{v}_{\!p}(a) \;\; , } \] | (SN.Alg.3) |
wobei $ ω $ ein transfiniter Wert ist und nach unseren Axiomen gilt, dass für jedes $ q \in \mathbb{Q} \setminus \left\{ 0 \right\} $
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { ω + q\;\;\;\raise{-.14ex}{᠄}\mspace{-4.5mu}\neq\;\;\;ω \;\; . } \] | (SN.ÜV.30) |
Nun definieren wir den aufgeladenen Term
sowie das Basiselement, wie bereits aus Formel SN.Ein.26 bekannt,
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \s\;\;\;≔\;\;\;\prod_{\substack{p \in \mathbb{P}}} p^{ω} \;\; . } \] | (SN.Ein.26) |
Eine ZFC-konforme Definition der Eigenschaften unseres unendlichen Produkts der superialen Basis $ \s $ über $ p $-adische Bewertungen findet sich auf der Seite ›Die ZFC-Modellkonstruktion der Superial-Zahlen‹.
Beachte, dass in $ \s $ für jede Primzahl $ p $ exakt der Exponent $ ω $ auftritt.
Dann folgt
Das bedeutet, wir können schreiben
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Leftrightarrow\hspace{10mm}a \cdot \s\;\;\;=\;\;\;\mathrm{P}(a) \;\; . } \] | (SN.Alg.9) |
Da $ \mathrm{P}(a) $ in unserem System für jede relevante Primzahl $ p $ den Exponenten $ ω + \mathrm{v}_{\!p}(a) $ trägt, ist $ \mathrm{P}(a) $ in jeder Komponente „aktual unendlich teilbar“ und gehört somit zu den ganzen Superial-Zahlen $ \mathbb{S}_{\Z} $.
Daraus folgt, dass
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { a \cdot s\;\;\;\in\;\;\;\mathbb{S}_{\Z} \;\; . } \] | (SN.Alg.10) |
Mit anderen Worten: Jede reell algebraische Zahl $ a $ kann in das Superial-Zahlensystem eingebettet werden, indem man sie mit $ \s $ multipliziert. Und wir sehen auch, dass $ a $ nicht die Größenordnung von $ \s $ verändert, weil $ a $ reell algebraisch und damit endlich ist. Damit sind alle notwendigen Kriterien für sinnvolle Koeffizienten der Superial-Zahlen erfüllt.
Schlussfolgerung:
Unter der Annahme, dass in unserem erweiterten System $ ω + q \neq ω $ für $ q \neq 0 $ gilt,
besitzt jede reell algebraische Zahl $ a $ die transfinite Darstellung
woraus unmittelbar folgt, dass $ a \cdot s \in \mathbb{S}_{\Z} $ wahr ist. Somit sind alle reell algebraischen Zahlen als sinnvolle Koeffizienten der Superial-Zahlen in diese eingebettet und wir finden, dass die Menge $ \mathbb{A}_{\S} $ der sinnvollen Koeffizienten der Superial-Zahlen gleich der Menge aller reell algebraischen Zahlen $ \mathbb{A}_{\R} $ ist
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \boxed{\;\; \mathbb{A}_{\S}\;\;\;=\;\;\;\mathbb{A}_{\R} \;\;} \;\; , } \] | (SN.Alg.12) |
was zu beweisen war.
Abermals wird deutlich, welche grundsätzliche Bedeutung die Superial-Zahlen für die Zahlentheorie haben; wie tief sie mit den Grenzen der Zahlenmengen verbunden sind.
| ▾ | Alter Ansatz mit elliptischen Integralen: |
Wurzeln aus Polynomen
Elliptische Integrale und ähnliche algebraische Werte
(In Arbeit …)
Nach allem, was ich über algebraische Zahlen herausfinden kann, sind die reelwertigen Lösungen der Nullstellen von Polynomen entweder Radikale(Verweis), also durch bereits oben betrachtete Wurzelausdrücke darstellbar, oder es sind elliptische Integrale(Verweis), für die Nullstellen von Polynomen 5. oder höheren Grades.(Verweis)
Elliptische Integrale sind Integrale über Wurzeln aus Polynomen, also unendliche Summen über Wurzeln aus Polynomen. Da die Ausdrücke der Polynome jedes Summanden damit algebraische Radikale oder gegebenenfalls wieder endliche oder unendliche Summen algebraischer Radikale sind, die gegen einen endlichen Wert konvergieren, bleiben es doch Summen algebraischer Radikale.
Summen algebraischer Radikale, ob endliche oder unendliche, die zu endlichen Werten konvergieren, verhalten sich wie im vorstehenden Abschnitt Summen und Differenzen von Wurzeln beschrieben und sind damit im Produkt mit der superialen Basis $ \s $ natürliche Superial-Zahlen die summiert wieder ebensolche ergeben.
Wie allgemein dies gilt, können wir an einem Beispiel beobachten.
Als Beispiel betrachten wir als erstes das allgemeine elliptische Integral der I. Art in der Jacobi-Form:
Nach der Definition eines Integrals mit Superial-Zahlen als Summe, nach Kapitel Die Integration, entspricht dies:
Nehmen wir an, dass dieses Integral im Produkt mit $ \s $
zu den natürlichen Superial-Zahlen gehört, dann erhalten wir durch Ausmultiplizieren
wobei diese Summe sich insofern plausibel in die Fundierung der Superial-Zahlen einfügt, als dass ihre zählende Variable ihre Werte per Definition „nur“ aus den möglichen und sinnvollen Superial-Zahlen schöpft. Das bedeutet, dass die Koeffizienten der Superial-Zahlen der zählenden Variable auch Realanteile der algebraischen Zahlen sind und dadurch die summierten Ausdrücke wieder Realanteile algebraischer Zahlen ergeben. Dies ist in sich selbst plausibel.
Nun ist es so, dass die Definition der Ableitung und des Integrals per Superial-Zahlen mit der superialen Basis $ \s $ die Besonderheit, dass die aktual unendlichen Anteile bei der Ableitung von rein endlichen Funktionen nicht verschwinden. Dagegen müssen bei der Integration aktual unendliche Anteile hinzugefügt werden, um rein endliche Funktionen zu erhalten. Dies bedeutet, wir müssen die Formel modifizieren:
Da alle obigen Summanden ganze Superial-Zahlen sind
(Wie gehen wir hier damit um, dass $ x $ in der Integralsumme auch superial kleine Anteile enthalten kann? Werden die hier eh zu endlichen ganzen Zahlen? Bei $ x^{2} $ wohl eher nicht. Oder können wir das Integral oben so definieren, dass es passt? Oder heben sich die superial kleinen Anteile erst beim Summieren auf?)
(In Arbeit …) und die Summe zweier ganzer Superial-Zahlen immer zu dieser Menge gehört, folgt daraus, dass die untersuchte Summe
| \[ \definecolor{formcolor}{RGB}{0,0,0} \color{formcolor} { \Rightarrow\hspace{10mm}n^{\frac{ 1 }{ y }} \cdot \s + n^{\frac{ 1 }{ z }} \cdot \s\;\;\;\in\;\;\;\mathbb{S}_{N} \;\;, } \] | (SN.Alg.20) |
unter den obigen Bedingungen, immer eine natürliche Superial-Zahl ist, was wir zeigen wollten.
(In Arbeit …) So sind dann auch algebraische Zahlen aus Summen zweier oder mehrerer Wurzeln, oder ihrer jeweiligen Kehrwerte, als Faktoren der superialen Basis $ \s $ natürliche Superial-Zahlen möglich.
(In Arbeit …) Damit haben wir für alle irrationalen algebraischen Koeffizienten durch Beweis überprüft, dass ihre Produkte mit der superialen Basis $ \s $ zu den natürlichen Superial-Zahlen gehören.
| → |
Fußnoten |
|
| 1. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Algebraische Zahl. | |
| 2. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Transzendente Zahl. | |
| 3. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Grenzwert. | |
| 4. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Radikal (Mathematik), Auflösung eines Polynoms durch Radikale. | |
| 5. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, P-adische Zahl. | |
| 6. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Pythagoreisches Tripel. | |
| 7. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, P-adische Zahl, Konstruktion, Analytische Konstruktion, Exponentenbewertung. | |
| 8. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Valuation ring. | |
| 9. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Integrality and valuation rings. | |
| 10. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Valuation ring. | |
| 11. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Ganzes Element Vgl. Wikipedia, Integral element. | |
| 12. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Ganzes Element Vgl. Wikipedia, Integral element Vgl. Wikipedia, Integrally closed domain Vgl. Wikipedia, Normalität. | |
| 13. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Radikal (Mathematik), Auflösung eines Polynoms durch Radikale. | |
| 14. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Algebraische Zahl. | |
| 15. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, P-adische Zahl. | |
| 16. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, P-adische Zahl, Konstruktion, Analytische Konstruktion, Exponentenbewertung. | |
| 17. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Primfaktorzerlegung. | |
| 18. |
(Primärliteratur einfügen!) Internet: Vgl. Wikipedia, Elliptische Integrale, Vollständige elliptische Integrale, Definition der vollständigen elliptischen Integrale. |
| |
Stand 20. November 2025, 23:00 CET.
-
Permanente Links:
(Klicke auf die Archivlogos
zum Abruf und Ansehen
der Archive dieser Seite.) -

-
archive.todaywebpage capture